Idee
Leistungen
Forschung & Beratung
Schriftenreihe
Personalien
Links
Idee
Leistungen
Forschung & Beratung
Schriftenreihe
Personalie
Links
Idee
Leistungen
Forschung & Beratung
Schriftenreihe
Personalie
Links
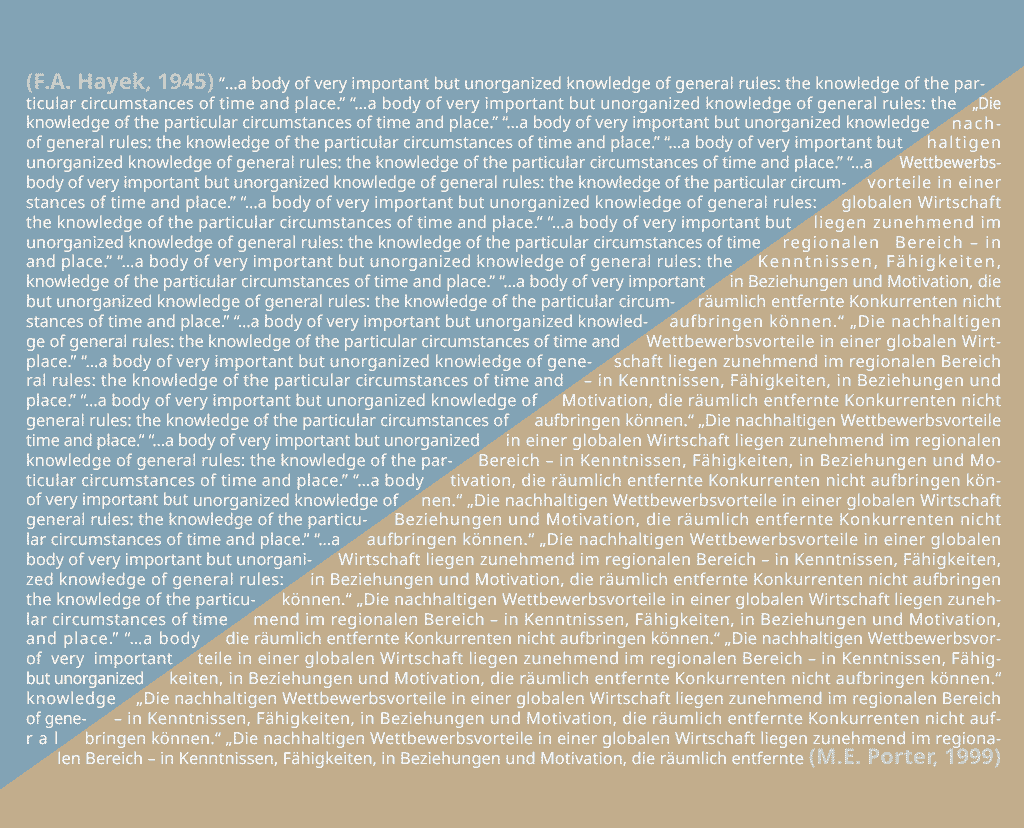
Idee
Leistungen
Forschung & Beratung
Schriftenreihe
Personalie
Links
IDEE
Umbrüche als Chance
Die wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Umbrüche unserer Zeit verändern den Wettbewerb der Standorte. Es zeichnet sich ab, dass die internationalen und nationalen Dimensionen des Wettbewerbs immer stärker durch einen Wettstreit der Regionen ergänzt werden.
Einen Wettstreit, der die regionalen Unternehmen und Institutionen mit all seinen Chancen und Gefahren in besonderer Unmittelbarkeit fordert:
Hierbei wird es nicht mehr ausreichen, sich alleine auf traditionelle Standortfaktoren zu verlassen. Vielmehr wird es zunehmend um die Erfindung neuen Wissens gehen; Wissen, das die Voraussetzung bildet, neue Fragestellungen zu beantworten und vorerfahrungslose Situationen zu bewältigen.
Erfindung neuen Wissens
Die Grundlage für die Erfindung von neuem, unverwechselbarem und einzigartigem Wissen ist das in einer Region naturgemäß in den Köpfen und im Tun der Menschen vorhandene Erfahrungswissen.
Es gilt, dieses oft unverbundene Wissen durch gezielte Prozesse zusammenzuführen und es für die jeweiligen Akteure und Institutionen nutzbar zu machen.
Das so neu entstehende, regionalspezifische Erfahrungswissen sichert den Beteiligten in der individuellen Verwertung Wettbewerbsvorteile und wirtschaftlichen Erfolg.
Wenn die Region wüsste, was sie weiß
Ziel ist es, das vor Ort vorhandene Erfahrungswissen systematisch für die Weiterentwicklung der Regionen zu nutzen.
Das Institut steuert diese regionalen Entwicklungsprozesse auf breiter Ebene und unterstützt die handelnden Akteure und Institutionen sowohl in struktureller als auch in qualifikatorischer Hinsicht (vgl. dazu die Leistungen im Überblick).
(C) 2020: IzSRE, alle Rechte vorbehalten
LEISTUNGEN
- Prozessbegleitung und -steuerung
- Moderation
- Projektmanagement
- Entwicklung von Zukunftsszenarien
- Einrichtung von Frühwarnsystemen
- Gestaltung von Risikodialogen
- Durchführung von Innovationswerkstätten
- Aufbau und Pflege von Wissensbörsen, Datenbanken sowie regionalen Netzwerken (Intranet)
- Prozessbegleitung und -steuerung
- Moderation
- Projektmanagement
- Entwicklung von Zukunftsszenarien
- Einrichtung von Frühwarnsystemen
- Gestaltung von Risikodialogen
- Durchführung von Innovationswerkstätten
- Aufbau und Pflege von Wissensbörsen, Datenbanken sowie regionalen Netzwerken (Intranet)
FORSCHUNG & BERATUNG
Bei allen Forschungs- und Beratungsprojekten des Instituts wird es auch in den kommenden Jahren auf der einen Seite um die gezielte Zusammenführung bisher unverbundenen Wissens relevanter Akteure und Institutionen gehen. Hierbei sichert das neu entstehende, unverwechselbare und einzigartige Fusionswissen den Beteiligten in der individuellen Verwertung Wettbewerbsvorteile und wirtschaftlichen Erfolg.
Hayek v., F. A. (1945): The Use of Knowledge in Society, in: The American Economic Review, Volume XXXV (9/1945), S. 519 -530.


Auf der anderen Seite initiiert und begleitet das IzSRE Prozesse, bei denen die Synergiepotentiale zwischen den einzelnen Wissensträgern im Vordergrund stehen; Potentiale, die Raum sowohl für gegenseitige Produkt- und Prozessinnovationen als auch für Steigerungen der jeweiligen Effizienz beinhalten.
Porter, M.E. (1999): Unternehmen können von regionaler Vernetzung profitieren. Trotz Globalisierung liegen viele langfristige Wettbewerbsvorteile direkt vor der Haustür, in: Harvard Business Manager, 3/1999, S. 51-63.
Bei allen Forschungs- und Beratungsprojekten des Instituts wird es auch in den kommenden Jahren auf der einen Seite um die gezielte Zusammenführung bisher unverbundenen Wissens relevanter Akteure und Institutionen gehen. Hierbei sichert das neu entstehende, unverwechselbare und einzigartige Fusionswissen den Beteiligten in der individuellen Verwertung Wettbewerbsvorteile und wirtschaftlichen Erfolg.
Hayek v., F. A. (1945): The Use of Knowledge in Society, in: The American Economic Review, Volume XXXV (9/1945), S. 519 -530.

Auf der anderen Seite initiiert und begleitet das IzSRE Prozesse, bei denen die Synergiepotentiale zwischen den einzelnen Wissensträgern im Vordergrund stehen; Potentiale, die Raum sowohl für gegenseitige Produkt- und Prozessinnovationen als auch für Steigerungen der jeweiligen Effizienz beinhalten.
Porter, M.E. (1999): Unternehmen können von regionaler Vernetzung profitieren. Trotz Globalisierung liegen viele langfristige Wettbewerbsvorteile direkt vor der Haustür, in: Harvard Business Manager, 3/1999, S. 51-63.

Bei allen Forschungs- und Beratungsprojekten des Instituts wird es auch in den kommenden Jahren auf der einen Seite um die gezielte Zusammenführung bisher unverbundenen Wissens relevanter Akteure und Institutionen gehen. Hierbei sichert das neu entstehende, unverwechselbare und einzigartige Fusionswissen den Beteiligten in der individuellen Verwertung Wettbewerbsvorteile und wirtschaftlichen Erfolg.
Hayek v., F. A. (1945): The Use of Knowledge in Society, in: The American Economic Review, Volume XXXV (9/1945), S. 519 -530.


Auf der anderen Seite initiiert und begleitet das IzSRE Prozesse, bei denen die Synergiepotentiale zwischen den einzelnen Wissensträgern im Vordergrund stehen; Potentiale, die Raum sowohl für gegenseitige Produkt- und Prozessinnovationen als auch für Steigerungen der jeweiligen Effizienz beinhalten.
Porter, M.E. (1999): Unternehmen können von regionaler Vernetzung profitieren. Trotz Globalisierung liegen viele langfristige Wettbewerbsvorteile direkt vor der Haustür, in: Harvard Business Manager, 3/1999, S. 51-63.
SCHRIFTENREIHE
Bisher erschienen in der Schriftenreihe des ISRE:
1.) M. Stuwe, Wenn die Region wüsste, was sie weiß. Die Rolle der Fachhochschulen im regionalen Wissenstransfer, Schriftenreihe des IzSRE, Nr.1, 12/01, Heide 2001.
Your Subtitle Goes Here
„Wenn die Region wüßte, was sie weiß“
Die Rolle der Fachhochschulen im regionalen Wissenstransfer
von
M. Stuwe 1)
- „Global The bigger the world economy, the more powerful its smallest players.“ 2) Es ist schon auffällig: Während auf der einen Seite Schlagworte wie „Globalisierung“, „Internationalisierung“, „Deregulierung“ etc., unbegrenzte Märkte, schnellere und kostengünstigere Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten sowie die freie Verfügbarkeit von Wissen eigentlich auf einen Bedeutungsverlust der Standorte hinweisen, zeichnet sich diese Entwicklung generell jedoch nicht ab – im Gegenteil: Für einige Regionen scheint es sogar angesichts der Komplexität und Dynamik einer immer mehr auf Wissen beruhenden weltwirtschaftlichen Entwicklung eine Renaissance der Standortrelevanz zu geben. 3) Was sind das für Erfolgsfaktoren, mit denen sich einige Standorte in den entwickelten Industrieländern zu Boomregionen profilieren; welche Rahmenbedingun- gen müssen hierfür vorliegen; wie können diese gefördert werden?
- Verbindendes und zentrales Kennzeichen prosperierender Standorte im Wettbewerb der Regionen ist die grundsätzliche Bereitschaft aller Akteure und Institutionen, sich mit Veränderungsprozessen positiv, aktiv und vorausschauend auseinander zu setzen. 4) Erfolgreiche Qualifizierungsmuster lernender Regionen beinhalten somit:einen institutionellen Rahmen, der es erlaubt, das in einer Region so viel- fältig vorhandene Wissen auch zu managen (Regionales Wissensmanage- ment oder: „wenn die Region wüsste, was sie weiß“)Erst in der Zusammenführung und im Austausch des in der Region naturgemäß verstreut vorhandenen, dezentralen Wissens (endogene Potentiale) mit externen Einflüssen und Entwicklungstendenzen entstehen die Kraftfel- der, die den „Nährboden“ für neues Wissen und innovative Prozesse, für Wettbewerbsvorsprünge und wirtschaftlichen Erfolg ausmachen. 5)
(1: Der Autor ist Professor für Unternehmensführung / Strategisches Management an der Fachhochschule Westküste und wissenschaftlicher Leiter des Instituts zur Steuerung Regionaler Entwicklungsprozesse (IzSRE).
(2: J. Naisbitt, London 1994, Kap.1.
(3: Vgl. M. E. Porter, Unternehmen können von regionaler Vernetzung profitieren. Trotz Globalisierung liegen viele langfristige Wettbewerbsvorteile direkt vor der Tür, in: HARVARD BUSINESS Manager, 3/1999, S. 51-63, hier
S. 51.
(4: Vgl. hierzu: Profilierung des Großraumes Graz zur Lernenden Region. Ein ADAPT-Projekt an der Karl-Franzens
Universität Graz, Graz / Austria.
(5: Vgl. E. Helmstädter, Von der Wissensteilung zur dezentralen Wissensnutzung. Die Kosten gesellschaftlicher
Interaktion und der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, in: HANDELSBLATT v. 16.06.1999, hier S. 63.
die Fähigkeit von Personen und Institutionen zu unvoreingenommenen Denkweisen sowie die Bereitschaft, traditionelle Zuordnungen und Abgrenzungen zu überwinden
den Mut, Laborkapazitäten und Experimentierfelder für vielfältigste Versuchsanordnungen bereitzustellen und die Risiken überraschender Resultate auch zu nutzen 6)
sowie das Reifen einer umfassenden Sensibilität, Signale und Informationen frühzeitig wahrzunehmen, mögliche Entwicklungsprozesse hieraus abzuleiten, sie gezielt zu analysieren und letztlich entsprechende Erkenntnisse erfolgreich zu verwerten 7)
- Fachhochschulen mit ihrer anwendungsorientierten Ausrichtung von Forschung und Entwicklung sowie des Wissenstransfers stellen exakt das Bindeglied zwischen globalen Entwicklungsszenarien einerseits und den regionalen / lokalen (Re)aktionspotentialen andererseits dar.Ihr Zugang zu wichtigen Ressourcen und Informationen der Region, ihre Beziehungen und direkten Verbindungen – letztlich ihr lokaler „Insiderstatus“ ist in einzigartigerweise gepaart mit branchenübergreifenden, internationalen Kontakten und Informationsquellen. (8Ihre Aktualität sowie branchen- und unternehmensbezogene Neutralität sichert in Permanenz und Breite die „Spiegelung“ überregionaler Ereignisse und Entwicklungstendenzen mit lokalen Verhältnissen und Prozessen.Die vielfältigen Möglichkeiten zur Zusammenführung von wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Kompetenz im Interesse des Standortes qualifizieren die Fachhochschulen und die in ihrem Umfeld angesiedelten Institute zu federführenden Instanzen im Prozess des regionalen Lernens.
- Der Wettbewerb der Standorte verlangt von den Hochschulen in der Region und ihren Instituten eine konzertierte Ausrichtung ihrer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, ihres Transfers an Wissen und Technologie sowie ihres komplementären Lehrprofils auf die kritischen Erfolgsfaktoren der Region; im Einzelnen geht esbeim Regionalen Wissensmanagement um die Schaffung von interdisziplinären, interinstitutionellen und interpersonellen Plattformen, auf denen die dezentralen, endogenen Wissenspotentiale zusammengeführt und mit externen Entwicklungen und Erkenntnissen abgeglichen werden (z.B.: Aufbau und Moderation einer regionalen „Wissensbörse“)
6): „Wej-ji“, die chinesische Bezeichnung für Risiko, setzt sich zusammen aus den Schriftzeichen für „Chance“ und „Gefahr“, in: Gesellschaft und Unsicherheit. Bayerische Rückversicherung AG, Mü nchen 1987, Vorwort.
7): Vgl. A. Lehmann u. S. Ruf, Frühwarnsysteme in der Assekuranz – Schlagwort oder strategische Option?, in: Versicherungswirtschaft (VW) 7/95, S. 366-371. 8): Vgl. M. E. Porter, a.a.O., hier S. 62.
bei den Qualifizierungsprozessen für die handelnden Akteure um die Konzeption und Durchführung von regionalen Managementprogrammen, deren vorrangiges Lernziel das erfolgreiche Agieren auf obigen „Plattfor- men“ ist (z.B.: Maßnahmen / Aktionen zur Überwindung branchenbezogener und institutioneller Denkblockaden)
beim Aufbau von Laborkapazitäten und Experimentierfeldern um die Zusammenführung öffentlicher / privater Anliegen mit dem Ziel, regionalspezifische Entwicklungsprozesse einzuleiten (z.B.: „Welche Auswirkungen hat die lokal differenzierte Veränderung der Bevölkerungsstruktur auf die Nach- frage nach öffentlichen Dienstleistungen und entsprechenden privaten Zu- lieferungen?“)
im Rahmen eines Regionalen Risikodialogs um das Angebot an Veranstaltungen, deren grundsätzliche thematische Relevanz und Problematik auf die besonderen regionalen Belange abzustellen ist (z.B.: Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik; welche spezifischen Gestaltungsräume gibt es in der jeweiligen Region?)
- Die konzertierte Ausrichtung von Forschung und Entwicklung, Wissenstransfer sowie Lehre auf die Erfolgsfaktoren einer Region bietet für die Fachhochschulen und die in ihrem Umfeld angesiedelten Instituten die einzigartige Chance einer profilprägenden Verzahnung ihrer Aufgabenbereiche.Auch die in der Regel an betrieblichen Inhalten orientierten Diplomarbeiten, Praxissemester sowie regionalen Projekte studentischer Unternehmensberatungen verstärken die wechselseitigen Wissensströme zwischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen und der Hochschule.Die Ausschöpfung regionaler und lokaler Innovationspotentiale positioniert die Fachhochschulen in den Mittelpunkt regionaler Lernprozesse; Prozesse, deren Erfolg letztlich über die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbskraft eines Standortes entscheiden. (9
9): Vgl. M. Stuwe, Staatsversagen und unternehmerische Verantwortung – „Changemanagement“ als politischer Gestaltungsauftrag in der Versicherungswirtschaft, in: Versicherungswirtschaft (Sonderdruck), 52. Jahrgang, Heft 6, 15.03.1997.
Hier können Sie die Druck-Version dieses Artikels (als Pdf-Datei) herunterladen:
DOWNLOAD
2.) G. Ott, Wissenstransfer in strukturschwachen Regionen am Beispiel der Westküste Schleswig-Holsteins – Die Bedeutung der Fachhochschule Westküste im Zentrum der regionalen Transferprozesse, Diplomarbeit im Rahmen der Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 2, 07/04, Heide 2004.
Your Subtitle Goes Here
3.) M. Stuwe, Wissen und Wettbewerb – Die Rolle des dezentralen Erfahrungswissens im Wettstreit der Regionen, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 3, 09/04, Heide 2004.
Your Subtitle Goes Here
4.) M. Stuwe, RegionaleQualitätsPartnerschaft Schleswig-Holstein (RQPSH) – Das Nutzenspektrum für Kreditinstitute in Schleswig-Holstein, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 4, 06/06, Heide 2006.
Your Subtitle Goes Here
5.) M. Stuwe, RegionaleQualitätsPartnerschaft Schleswig-Holstein (RQPSH) – Prozessinnovation für den Mittelstand in einer wissensbasierten Gesellschaft. Überarbeitete und erweiterte Fassung eines Vortrages anlässlich des KfW – Forums der deutschen Mittelstandsforschung vom 30.-31.10.2008 in Frankfurt/Main, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 5, 03/09, Heide 2009.
Your Subtitle Goes Here
6.) M. Stuwe, travemündesailing – MaritimesQualitätsCluster für Travemünde und Lübeck (MQC), Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 6, 04/12, Travemünde 2012.
Your Subtitle Goes Here
7.) M. Stuwe, RegionalerRisikoDialog (RRD) – Strategische Entwicklungsperspektiven für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Schleswig-Holstein, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 7, 05/12, Heide 2012.
Your Subtitle Goes Here
8.) S. Munir, Arbeitsintegration – Das schwedische Modell zur Eingliederung von Migranten unter besonderer Berücksichtigung sprachlicher und kultureller Aspekte, Bachelor Thesis im Rahmen der Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 8, 06/12, Heide 2012.
Your Subtitle Goes Here
Hier können Sie die Druck-Version dieses Artikels (als Pdf-Datei) herunterladen:
DOWNLOAD
9.) M. Stuwe, Freiheit und Verantwortung. Gestaltungsauftrag und Gestaltungspotenziale in der nachberuflichen Lebensphase, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 9, 12/14, Heide 2014.
Your Subtitle Goes Here
10.) A.-C. Kebeck, M. Stuwe, Zukunftsfähigkeit und Wissensmanagement. Die Produktion und Verwertung von neuem Wissen in Netzwerken, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 10, 12/14, Heide 2015.
Your Subtitle Goes Here
11.) M. Stuwe, FehmarnBeltQuerung (FBQ). Entwicklungsschub für die intermodalen Verkehre via Lübeck, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 11, 08/15, Heide 2015.
Your Subtitle Goes Here
12.) M. Stuwe, Korridorentwicklung und Raumprofilierung. Der Studienschwerpunkt Nordic Management in einem neuen nordeuropäischen Kontext, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 12, 11/16, Heide 2016.
Your Subtitle Goes Here
13.) M. Stuwe, RealLaborLogistik. Die wissenschaftliche und praxisorientierte Begleitung der mittelständischen Logistikunternehmen im Prozess der digitalen Transformation, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 13, 03/19, Heide 2019.
Your Subtitle Goes Here
14.) M. Stuwe, MaritimesQualitätsCluster Travemünde (MQC) – Stand und Perspektiven, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 14, 07/21, Lübeck 2021.
Your Subtitle Goes Here
MaritimesQualitätsCluster Travemünde (MQC)
Stand und Perspektiven
von
M. Stuwe (1
- Zentrales Ergebnis der im Jahre 2009 für das Stadtmarketing-Zielsystem Lübeck in Auftrag gegebenen „Analyse des Erfolgsmusters der Marke Lübeck“ war die Dominanz (71%) maritimer Markenbausteine für Lübeck und Travemünde.
(Vgl. BRANDMEYER MARKENBERATUNG, Stadtmarketing-Zielsystem Lübeck. Das Erfolgsmuster der Marke Lübeck, 06.07.2009)
- Vertiefende wissenschaftliche Untersuchungen am Institut zur Steuerung Regionaler Entwicklungsprozesse (IzSRE) an der Fachhochschule Westküste (FHW) bestätigten das hohe Clusterpotenzial für Lübeck-Travemünde im maritimen Bereich und empfahlen den handelnden Akteuren vor Ort, den Aufbau eines MaritimenQualitätsClusters (MQC) zunächst für den Bereich des Segelsports.
- Ab 2012 begannen die führenden Hotels in Travemünde mit einer systematischen Bündelung ihrer Gästebedarfe i.S. Segeln auf ein einheitliches Portal. Während die Zugänge zur Plattform auf die spezifischen Bedingungen in den einzelnen Häusern zugeschnitten wurden, (Print, Homepages, apps…) garantierte das Segelportal ausreichende und differenzierte Verfügbarkeiten sowie die notwendigen Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
- Seit dem 26.02.2019 wird das Segelportal durch den Verein travemündesailing e.V. getragen und steht u.a. über den LTM Veranstaltungskalender allen Gästen des Seebades zur Verfügung. Sitz des Vereins ist die BÖBS-WERFT in Travemünde. Mit seiner Satzung und in seinem Zukunftsentwurf unterstützt der Verein nicht nur den Segelsport, sondern darüberhinaus den Aufbau einer einheitlichen Internet Plattform für alle Wassersportarten in Travemünde und der LübeckerBucht.
- Auf der Grundlage der bereits 2015 durch das Institut zur Steuerung Regionaler Entwicklungsprozesse (IzSRE) und mit Hilfe der Travemünder Hotellerie begonnenen Untersuchungen zur „Dichte und Breite des Wassersportangebots in der Lübecker Bucht“, wurde am 01.07.2020 das Portal watersportsLübeckerBucht www.wslb.de ins Leben gerufen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
- Die so entstandene neue Plattform verbindet hierbei sowohl wassersportliche Angebote als auch künstlerisch/kulturelle Aktivitäten miteinander und setzt seinen Focus bewußt auf die ganze LübeckerBucht, von Travemünde über Fehmarn bis Boltenhagen.
- Die Wassersportmöglichkeiten dieses einzigartigen Reviers umfassen reizvolle und abwechslungsreiche Fluß, Seen- sowie beeindruckende Küstenlandschaften mit guten Windbedingungen und sicherer Infrastruktur.
- Aber nicht nur die landschaftlichen Besonderheiten und wassersportlichen Angebote kennzeichnen das Bild der LübeckerBucht – auch die künstlerischen, kulturellen und kulinarischen Rahmenbedingungen prägen das Bild einer Bucht, in deren Mittelpunkt das verbindende Element „Wasser“ steht: ob es sich hierbei um Bilder von Stränden, Skulpturen im Seewind oder Chöre mit maritimen Bezug handelt, immer zieht sich das Meer als blauer Faden durch die verschiedenen Erlebniswelten und eröffnet überraschende Perspektiven.
- Das neue Portal …
- spiegelt den Erlebnisraum LübeckerBucht in seiner ganzen Vielfalt, Offenheit und Weite.
- gibt detaillierte Informationen zu Segeltörns, Tauchrevieren…bis hin zu Angelgewässern und Kanurouten.
- bietet direkte Buchungsmöglichkeiten egal ob es sich hierbei um SUP Kurse, um Anwendungen in den SPA Bereichen ausgewählter Hotels oder um Tischbestellungen für ein Barbeque auf der Ostseeterasse eines rennomierten Restaurants handelt.
- begleitet den Gast während seines Aufenthalts mit tagesaktuellen Informationen zum künstlerischen und kulturellen Geschehen in seiner Umgebung und gibt nützliche Hinweise zu den gastronomischen Angeboten vor Ort.
- sichert dem Gast auch nach seiner Abreise die Teilhabe an der weiteren Ent- wicklung des Erlebnisraumes LübeckerBucht. Durch gezielten und kontinuierlichen Austausch mit touristischen Leistungsträgern vor Ort und lokalem Expertenwissen erhält der Gast so die Möglichkeit, über das Portal als Werkstatt an der zukünftigen Entwicklung von Produkten und Services in seinem Seebad mitzuwirken.
- In dieser Ausrichtung unterstützt die neue Plattform die Realisierung des Touristischen Entwicklungskonzeptes Lübeck.Travemünde 2030 (TEK) bei der
- klaren Fokussierung auf die Zielgruppen ‚Entschleuniger‘ und ‚Natururlauber‘
- Entwicklung neuer Produkte mit eigenem Profil und hoher Erlebnisqualität
- Profilierung des Erlebnisraumes Travemünde und seiner Promenadenvielfalt
- räumlichen und zeitlichen Lenkung von Besucherströmen
- behutsamen Erschließung sensibler Naturräume
- Am 01.01.2021 wurde das Portal watersportsLübeckerBucht aus dem Wissenschaftsbereich ausgegliedert und in eigener Rechtsform auf dem Gelände der BÖBS-WERFT in Travemünde angesiedelt. Die Geschäftsführung der neuen Plattform haben Mitglieder des Vereins travemündesailing e.V. übernommen.
Hier können Sie die Druck-Version dieses Artikels (als Pdf-Datei) herunterladen:
DOWNLOAD
15.) M. Stuwe, watersportsLübeckerBucht – Innovationsmanagement in maritimen Erlebnisräumen – überarbeitete und erweiterte Fassung eines Vortrages anlässlich der boot Düsseldorf vom 21. - 29. 01. 2023 in Düsseldorf, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 15, 11/23, Lübeck 2023.
Your Subtitle Goes Here
watersportsLübeckerBucht
Innovationsmanagement in maritimen Erlebnisräumen
von
Prof. Dr. M. Stuwe 1)
Erlebnisräume im Wettbewerb – letztlich ein Wettbewerb um Wissen!
- Ein neues Wettbewerbsverständnis Der Wettbewerb in maritimen Erlebnisräumen, oft fälschlicherweise verstanden als ein Ringen um spektakuläre Seebrücken und Strandpromenaden, zielgruppenorientierte Marketingkonzepte und ausgefeilte Buchungsportale, dürfte in der Zukunft einer postdigitalen Gesellschaft immer stärker ein Wettbewerb um das spezifische, in einer Region vorhandene Wissen der Akteure vor Ort sein.
- Dezentrales Erfahrungswissen Bereits im Jahre1945 wies der österreichische Nationalökonom und Nobelpreisträger F.A.v.Hayek auf ein Wissensformat hin, das er das dezentrale oder wettbewerbliche Erfahrungswissen nannte 2). Ein Wissens- und Erfahrungsschatz, der in den unabhängig voneinander agierenden Akteuren schlummere, enorm bedeutsam sei, aber unorganisiert; ein Wissen, das eigentlich nicht als streng wissenschaftlich bezeichnet werden kann, aber in ganz besonderer Weise die spezifischen Umstände und Bedingungen von „Raum und Zeit“ einzufangen vermag. Ein Wissen, das im Gegensatz zu den klassischen Wissensformen 3) eine einzigartige Chance bietet, relativ dauerhaft Wissens- und Anwendungsvorsprünge zu erzielen, da das in den Köpfen und im Tun vorhandene Erfahrungswissen naturgemäß am schwierigsten zu kopieren und nachzuahmen ist.
- Die Mobilisierung der Wissensproduktion So einzigartig und alleinstellend wie die Verwertungsmöglichkeiten des dezentralen oder wettbewerblichen Erfahrungswissens auch sind, so schwierig ist es allerdings auch, die Wissensproduktion auf dieser Ebene zu mobilisieren. Letztlich geht es hierbei darum, dass in den Köpfen und im Tun verstreut vorhandene Erfahrungswissen auch tatsächlich zusammenzuführen.
1): Bei dem Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete und erweiterte Fassung eines Vortrages, den der Verfasser anlässlich der boot Düsseldorf vom 21.-29.01.2023 gehalten hat.
2): …a body of very important but unorganized knowledge of general rules: the knowledge of the particular circumstances of time and place.“ F.A.v.Hayek, The Use of Knowledge in Society, in: The American Economic Review, Vol. XXXV, 9/1945, S. 519-530.
3): Grundlagenwissen/Transferwissen.
- Kodierung/Dekodierung Und genau hier, in dieser Zusammenführung der spezifischen/ganz unterschiedlichen Kernwissen liegt die eigentliche Herausforderung. So sind die jeweiligen Wissensbereiche aus Praktikabilitätsgründen mit einer Art „Schutzmantel“ umgeben (kodiert); wie z.B. bestimmte Handlungsroutinen, Sprachkulturen oder einer Art „trägergebundenen Intuition“ 4), die eine „Andockung“ der unterschiedlichen Kernwissen nicht ohne weiteres zulassen.Hierfür bedarf es einer Dekodierung der Kernwissen („Ablegen des Schutzmantels“) um sie „fusionsreif“ bzw. „verschmelzungsfähig“ zu machen, damit aus den verschiedenen Einzelwissen neues, unverwechselbares und einzigartiges Wissen entstehen kann.Ein Wissen, das aus der Fusion situationsbedingten Erfahrungswissens jedes einzelnen Akteurs hervorgegangen ist und exklusiv genau wieder diesen Akteuren zur Verfügung steht – zwecks individueller Kodierung, Verwertung und Sicherung von dauerhaften Wettbewerbsvorteilen.
- Mentale und qualifikatorische Voraussetzungen Entscheidende Voraussetzung für die Nutzung des dezentralen Erfahrungswissens in einer Region ist allerdings die Bereitschaft und die Qualifikation der vor Ort agieren den Personen und Institutionen:
- den Kern ihres individuellen Erfahrungswissens auch zu dekodieren
- ihr Wissen für die Fusion mit anderem Wissen auch zur Verfügung zu stellen
- das so entstandene neue Wissen anzunehmen und zu verwerten.
- Institutionelle Voraussetzungen Neben diesen mentalen und qualifikatorischen Bedingungen bedarf es des systematischen und gezielten Aufbaus einer Plattform/Netzwerks, auf/in dem sich die Interaktionen zwischen den potenziellen Partnern der Wissensfusion auch vollziehen können. Letztlich geht es hierbei um konsistente Laboranordnungen, in denen die Verschmelzungsprozesse kreativ aber auch disziplinierend begleitet werden.
- Die LübeckerBucht – ein Fusionslabor Mit dem Aufbau des Portals watersportsLübeckerBucht www.wslb.de ist es 2021 den Akteuren vor Ort gelungen in der LübeckerBucht eine Plattform zu etablieren, 5) auf der systematisch Verschmelzungsprozesse zwischen den Angeboten im Bereich des Wassersports mit dem Ziel stattfinden, neue Produkte mit maximaler Alleinstellungsqualität dem maritimen Erlebnisraum LübeckerBucht zur Verfügung zu stellen. 6)
- Destinationsentscheidung im Wandel Das bisher ‚eherne Gesetz‘ im Entscheidungsprozess der Gäste:a) Wahl des Urlaubsortes/der Region
b) Auswahl des Hotels
c) Suche nach geeigneten Freizeit- und Sportangebotenwurde durchbrochen und in eine neue Reihenfolge gestellt:a) Gezielte Wahl eines einzigartigen Freizeit- und Sportprodukts
b) In welcher Region/an welchem Ort finde ich dieses Angebot
c) Auswahl des Hotels 7)
4): Vgl hierzu grundsätzlich: G. Ott, Wissenstransfer in strukturschwachen Regionen am Beispiel der Westküste Schleswig-Holsteins. Die Bedeutung der Fachhochschule Westküste (FHW) im Zentrum der regionalen Transferprozesse, Schriftenreihe des Instituts zur Steuerung Regionaler Entwicklungsprozesse (IzSRE), Nr. 2, 07/04, Heide 2004.
5): Vgl. zur ausführlichen Chronologie: M. Stuwe, MaritimesQualitätsCluster Travemünde (MQC) – Stand und Perspektiven, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 14, 07/21, Lübeck 2021.
6): Sail&Bike / ‚Kinder klettern am Meer‘ / SUP&YOGA / Management&Segeln / Sail&Walk…
7): Cruising the Bay‘ (Anlage)
Bisher erschienen in der Schriftenreihe des IzSRE
- M. Stuwe, Wenn die Region wüsste, was sie weiß. Die Rolle der Fachhochschulen im regionalen Wissenstransfer , Schriftenreihe des IzSRE, Nr.1, 12/01, Heide 2001.
- G. Ott, Wissenstransfer in strukturschwachen Regionen am Beispiel der Westküste Schleswig-Holsteins – Die Bedeutung der Fachhochschule Westküste im Zentrum der regionalen Transferprozesse, Diplomarbeit im Rahmen der Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 2, 07/04, Heide 2004.
- M. Stuwe, Wissen und Wettbewerb – Die Rolle des dezentralen Erfahrungs-wissens im Wettstreit der Regionen, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 3, 09/04, Heide 2004.
- M. Stuwe, RegionaleQualitätsPartnerschaft Schleswig-Holstein (RQPSH) – Das Nutzenspektrum für Kreditinstitute in Schleswig-Holstein, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 4, 06/06, Heide 2006.
- M. Stuwe, RegionaleQualitätsPartnerschaft Schleswig-Holstein (RQPSH) – Prozessinnovation für den Mittelstand in einer wissensbasierten Gesellschaft. Überarbeitete und erweiterte Fassung eines Vortrages anlässlich des KfW – Forums der deutschen Mittelstandsforschung vom 30.-31.10.2008 in Frankfurt/Main, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 5, 03/09, Heide 2009.
- M. Stuwe, travemündesailing – MaritimesQualitätsCluster (MQC) für Travemünde und Lübeck, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 6, 04/12, Travemünde 2012.
- M. Stuwe, RegionalerRisikoDialog (RRD) – Strategische Entwicklungsperspektiven für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Schleswig-Holstein, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 7, 05/12, Heide 2012.
- S. Munir, Arbeitsintegration – Das schwedische Modell zur Eingliederung von Migranten unter besonderer Berücksichtigung sprachlicher und kultureller Aspekte, Bachelor Thesis im Rahmen der Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 8, 06/12, Heide 2012.
- M. Stuwe, Freiheit und Verantwortung. Gestaltungsauftrag und Gestaltungs-potenziale in der nachberuflichen Lebensphase, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 9, 11/14, Heide 2014.
- A.-C. Kebeck, M. Stuwe, Zukunftsfähigkeit und Wissensmanagement. Die
Produktion und Verwertung von neuem Wissen in Netzwerken, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 10, 12/14, Heide 2014. - M. Stuwe, FehmarnBeltQuerung (FBQ). Entwicklungsschub für die intermodalen Verkehre via Lübeck, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 11, 04/15, Heide 2015.
- M. Stuwe, Korridorentwicklung und Raumprofilierung. Der Studienschwerpunkt Nordic Management in einem neuen nordeuropäischen Kontext, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 12, 11/16, Heide 2016.
- M. Stuwe, RealLaborLogistik. Die wissenschaftliche und praxisorientierte Begleitung der mittelständischen Logistikunternehmen im Prozess der digitalen Transformation, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 13, 03/19, Heide 2019.
- M. Stuwe, MaritimesQualitätsCluster Travemünde (MQC) – Stand und Perspektiven, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 14, 07/21, Lübeck 2021.
- M. Stuwe, watersportsLübeckerBucht – Innovationsmanagement in maritimen Erlebnisräumen – überarbeitete und erweiterte Fassung eines Vortrages anlässlich der boot Düsseldorf vom 21. – 29. 01. 2023 in Düsseldorf, Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 15, 11/23, Lübeck 2023.
Hier können Sie die Druck-Version dieses Artikels (als Pdf-Datei) herunterladen:
DOWNLOAD
16.) M. Stuwe, PASSATDIALOG Geopolitisches Portal für die Ostsee und ihre Anrainerstaaten
Your Subtitle Goes Here
PASSATDIALOG1)
Geopolitisches Portal für die Ostsee und ihre Anrainerstaaten
von
Prof. Dr. M. Stuwe
- Mit der Annexion der Krim 2014 und den hegemonialen Ansprüchen Rußlands in der Ukraine, ist die geopolitische Sensibilität in allen Teilen der Welt gewachsen.
- Insbesondere die Ostsee im Zentrum einer nordeuropäischen Sicherheits- und Wohlstandsarchitektur ist „…in den Fokus geopolitischer Interessen und Konflikte geraten“ 2) und wird eines der Prüffelder für ein gedeihliches Miteinander der Anrainerstaaten in der Zukunft sein.
- Die Stadt Lübeck in ihrer historischen Rolle als Hanse-Metropole und Wegbereiter für Frieden, Handel und Wohlstand erfährt in einer neuen „…geostrategischen Realität“ 3) eine Renaissance ihrer traditionellen Optik und Verantwortung.
- An der Nahtstelle zwischen der südlichen Ostsee und des nach der Fertigstellung der festen FehmarnBeltQuerung (FFBQ) östlichsten landgestützten Korridors zwischen Kontinental- und Nordeuropa, ist Lübeck in ganz besonderer Weise gefordert, den vielschichtigen Entwicklungen höchste Aufmerksamkeit zu schenken und Plattformen bereitzuhalten, die den Dialog zwischen allen Beteiligten auf Dauer sicherstellen. 4)
1) Die Viermastbark Passat, -eine der legendären Flying P-Liner aus dem damaligen Liniendienst zwischen Europa und Südamerika- liegt heute fest verankert an der Mündung des Flusses Trave in die südliche Ostsee und soll in den nächsten Jahren den PASSATDIALOG symbolisieren.
2) G.Swistek, M.Paul, Geopolitik im Ostseeraum. Die >>Zeitenwende<< im Kontext von kritischer maritimer Infrastruktur, Eskalationsgefahren und deutschem Führungswillen, in: Stiftung Wissenschaft und Politik. Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, SWP-Aktuell, Nr.6, Januar 2023, hier S.1.
3) Ders, a.a.O., hier S.2.
4) Vgl. M.Stuwe, ‘nordicjunction & balticports’ – Szenario 2030. Die Antwort Lübecks auf die feste FehmarnBeltQuerung, in: Institute of Northern-European Economic Research (INER). NBS Northern Business School Hamburg, Hamburg 23.06.2022, hier S.8.
- Die Einrichtung des PASSATDIALOG in Lübeck zielt exakt auf diese Forderungen ab und stellt in verschiedensten Formaten sicher, das
- relevante Ereignisse in diesen Kontexten überhaupt wahrgenommen
- und ihre Interdependenzen untereinander auch erkannt werden
- sowie schließlich in eine sachkundige Bewertung münden
Letztlich gilt es Räume zu schaffen, um Lösungspotenziale auszuloten und Wege zur präventiven Konfliktbewältigung aufzuzeigen.
- Die bisherigen Veranstaltungen im Rahmen des neuen Formats zeigen bereits eindrucksvoll den einzuschlagenden Weg für die Hansestadt Lübeck:

- Für die Zukunft zeichnen sich angesichts der exponierten Lage Lübecks am Berührungspunkt zwischen der südwestlichen Ostsee und dem neuen transseuropäischen Korridor Hamburg – Kopenhagen drei zentrale Themenfelder ab: 5)
- die Bedrohung kritischer maritimer sowie landgestützer Infrastruktur
- die potentielle Störung vitaler Seeverbindungswege
- die teilweise provokative Präsenz militärischer Einheiten und ihre Konsequenzen für Touristik und Freizeit
5) Vgl. G.Swistek, M.Paul, a.a.O., hier S. 4f.
- „Entscheidend ist, was wir nicht wissen – wenn wir es wissen, ist es zu spät.“
(R. Kellenberger, CEO SwissRe,1994). – Die gesellschaftliche Relevanz des neuen Portals dürfte entscheidend davon abhängen ob es gelingt, Formate zu entwickeln die:
a) nicht nur frühzeitig die Wahrnehmung relevanter Ereignisse möglich machen, sondern darüber hinaus
b) interdisziplinäre Pausibilitätskonstruktionen identifizieren, die Hinweise auf bevorstehende Ereignisse geben und daraus induzierte Entwicklungen ableiten. 6)
6) Vgl. hierzu ausführlich M. Stuwe, Freiheit & Verantwortung, in: Schriftenreihe des IzSRE, Nr. 9, 11/14, Heide 2014.
Hier können Sie die Druck-Version dieses Artikels (als Pdf-Datei) herunterladen:
DOWNLOAD
PERSONALIEN
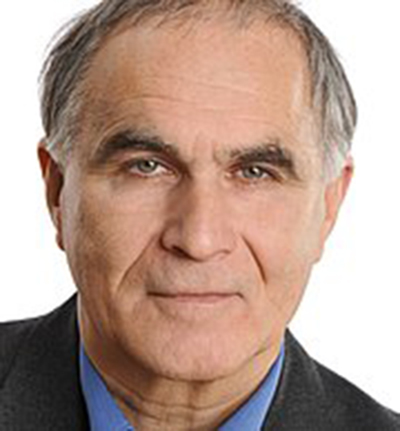

LINKS
watersportsLübeckerBucht
Die ganze Bucht auf einen Klick!
Die Wassersportmöglichkeiten in der LübeckerBucht von Travemünde über Fehmarn bis Boltenhagen, zeichnen sich durch eine nahezu flächendeckende Vielfalt und Dichte an wasser- und landseitigen Angeboten aus.


travemündesailing e.V.
Der Verein dient der Förderung des Wasser-, insbesondere des Segelsports in Lübeck-Travemünde und in der LübeckerBucht.

watersportsLübeckerBucht
Die ganze Bucht auf einen Klick!
Die Wassersportmöglichkeiten in der LübeckerBucht von Travemünde über Fehmarn bis Boltenhagen, zeichnen sich durch eine nahezu flächendeckende Vielfalt und Dichte an wasser- und landseitigen Angeboten aus.

travemündesailing e.V.
Der Verein dient der Förderung des Wasser-, insbesondere des Segelsports in Lübeck-Travemünde und in der LübeckerBucht.
watersportsLübeckerBucht
Die ganze Bucht auf einen Klick!
Die Wassersportmöglichkeiten in der LübeckerBucht von Travemünde über Fehmarn bis Boltenhagen, zeichnen sich durch eine nahezu flächendeckende Vielfalt und Dichte an wasser- und landseitigen Angeboten aus.


travemündesailing e.V.
Der Verein dient der Förderung des Wasser-, insbesondere des Segelsports in Lübeck-Travemünde und in der LübeckerBucht.
Kontakt
Institut zur Steuerung Regionaler Entwicklungsprozesse (IzSRE) p. Adr.
watersportsLübeckerBucht GbR
c/o BÖBS-WERFT GmbH
Travemünder Landstraße 304
23570 Lübeck-Travemünde
Telefon: 0172-6134048
E-Mail: info@izsre.de
Ihre Anfrage
*) Pflichtfelder
